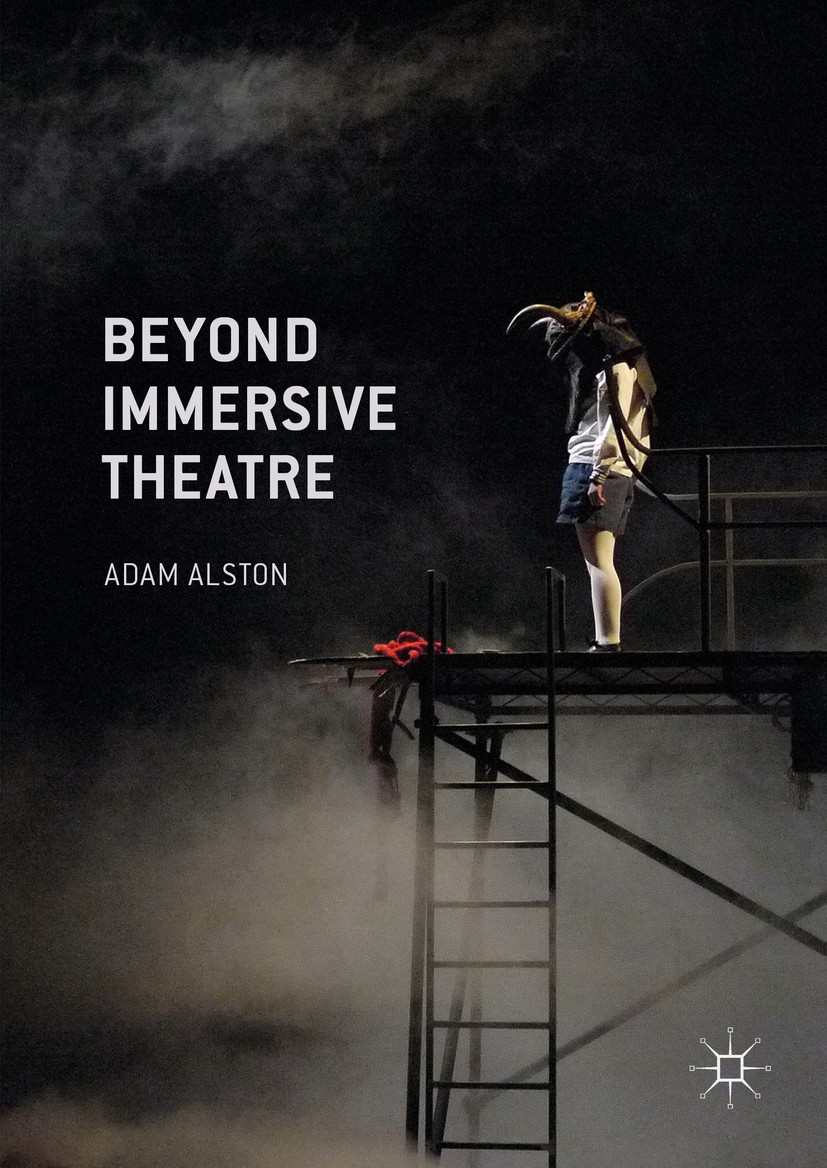Partizipation, aus dem Lateinischen für Teilnahme oder Teilhabe, hat insbesondere in der Pädagogik, der Soziologie und der Politik oftmals eine dezidiert emanzipatorische und legitimatorische Dimension. Die Vorstellung, «[a]ktive Beteiligung oder Partizipation bringe eine Selbstbestimmtheit der Mit-Tätigen mit sich» (Spohn 2015: S. 8) und eine Konnotation mit dem «Ermöglichen von Gleichheit und Gemeinschaftlichkeit, mit einer Emanzipation derer, die bislang keine Stimme hatten, und der Errichtung demokratischer Strukturen» (Ebd.) führte im Zusammenhang mit den Protest- und Demokratisierungsbewegungen der 1960er auch zu einem Anstieg künstlerischer Ausdrucksformen, die sich Partizipation – im Sinne einer aktiven Beteiligung des nicht mehr nur als passive Rezipient*innen verstandenen Publikums – zum Ausgangspunkt setzten.
«It’s a fight against audience apathy and the inertia that sets in when you’re stagnating in an auditorium. When you’re sat in an auditorium, the primary thing that is accessed is your mind and you respond cerebrally. Punchdrunk resists that by allowing the body to become empowered because the audience has to make physical decisions and choices, and in doing that they make some sort of pact with the piece. They’re physically involved with the piece and therefore it becomes vicseral.»
(Felix Barret, zitiert nach Alston 2016: S. 110)
Eine Kritik solcher Ansätze bezieht sich häufig auf die Theorien von Chantal Mouffe, Ernesto Laclau oder Jacques Rancier. Zwei der zentralen Argumente sind dabei, dass sich das Mitwirken der Rezipient*innen bei partizipatorischen Kunstprojekten oftmals in einem schon «aufgeteilten Raum struktureller Rahmenbedingungen» (Spohn 2015: S. 8) vollzieht – polemisch liesse sich sagen: eher im Rahmen paternalistischer Hilfeleistung als in einem Setting, das emanzipatorische Bewegungen ermöglicht – und zweitens, dass auch das Sehen, Hören, Fühlen und Denken in nicht explizit interaktiven Formaten eine intensive Form der Teilnahme darstellen kann, die alles andere als passiv sein muss (vgl. ebd.).
Einer dritten Form der Kritik folgt Adam Alston in seinem Buch Beyond Immersive Theatre, in dem er auf Publikumspartizipation beruhende Theaterformate vor dem Hintergrund aktueller kapitalistischer und gesellschaftlicher Tendenzen betrachtet. Viele der zeitgenössischen künstlerischen Formate bemühten zwar noch ein ähnliches emanzipatorisches Vokabular, «[but they] no longer promote the ‚coalitional identity politics, activist sensibilities or […] liberation from authorative narratives‘ that characterised much participatory performance practice in the twenthieth century and especially the 1960s and 1970s» (Alston 2016: S. 111). Vielmehr fungierten sie als eine Art experience machine (vgl. ebd.: S. 2-3) zur Herstellung von «stimulating and memorable experiences“ (Ebd.: S. 16) und seien geprägt von einer «objectification of audience experiences according to a logic that chimes with the commodification of experience elsewhere in the experience economy» (Ebd.). Seine Diagnose: «Commodity culture is no longer resisted so easily by the supposed ’non-reproducibility‘ of performance, because the experience economy has absorbed memorable experiences (always fleeting) as the ultimate commodity» (Ebd.: S. 157).
Weitere geteilte Merkmale zeitgenössischer partizipativer Theaterformen und neoliberal-kapitalistischer Logik sieht er in der «‘activation‘ of consumers as producing consumers» (Ebd.: S. 146): «neoliberalism ushers in haziness between modes of consumption and production, pitching producers as subjects whose immaterial labour is consumed as a productive source of capital, and consumers as producers or pseudo-producers whose experiential and ‚active‘ engagement with a product is appealed to in its design and/or marketing» (Ebd.: S. 16). Darin läge ein ähnlicher «romanticism of productivity in a scheme of production that draws value from affected subjects: a scheme that resources an audience’s participation in immaterial production, including their feeling bodies, intellectual and imaginative abilities, as well as the more noticeable productive exertion of energy in physical endeavour” (Ebd.: S. 222). Er weist auch auf die Prävalenz von “affective labour of both performers and productive participants” hin (Ebd.: S. 209) und betont die Nähe des Vokabulars von partizipativem Theater zu experiental marketing:
«One of the most fascinating aspects of the literature on experiential marketing, a particularly Schmitt’s writing on SEMs1, is the choice of terminology and the identification of modes of consumer engagement: relationality, the promotion of interaction, appealing to the creative and imaginative faculties, affective engagement, multi-sensory provocation… This kind of terminology and the modes of engagement it names are remarkably applicable to frameworks for immersion and participation.»
(Ebd.: S. 156)
Solche Verbindungen fasst er mit dem Begriff productive participation. Aspekte dieser differenziert er aus als narcissistic participation und entrepreneurial participation.
Narcissistic participation beschreibt dabei die Tendenz zeitgenössischer partizipativer Formate, die Anwesenheit des Publikums in und die Reaktionen dieses auf eine gestaltete Umgebung gegenüber den traditionellen Objekten ästhetischer Betrachtung (den Performer*innen, dem Bühnenbild, den gesprochenen Worten) in den Vordergrund zu rücken: «The audience experience produced by an audience relationship to a set of materials tends to be framed as the primary, aesthetically meaningful element» (Ebd.: S. 7). “It is not so much form, or dramaturgy, or concept, which are the ‚take home‘ aesthetic features […], rather, the experience is the artwork» (Ebd.: S. 48). Die Teilnehmer*innen seien angehalten «to engage with their own feeling bodies as an aesthetic site» (Ebd.), dadurch werde Introspektion gefördert.2 Entrepreneurial participation beschreibt die Tendenz, vom partizipierenden Publikum zu erwarten, in eine Performance zu investieren, indem sie Risiken eingehen und ein gewisses Mass an persönlicher Verantwortung für eine erfüllende Erfahrung individueller Entdeckung übernehmen. «Entrepreneurial participation is therefore predicated on entrepreneurialism, personal responsibility, and risk-taking, valorising each as productive features within a framework for audience immersion and opportunistic participation» (Ebd.: S. 133).
Diese Zusammenhänge bedeuten jedoch nicht, dass es notwendig ist, Publikumspartizipation als künstlerische Strategie zu verwerfen. Auch Adam Alston verfolgt seine Kritik heraus aus einer Zuneigung und Wertschätzung der Formate, die er untersucht. Den letzten Abschnitt widmet er Arbeiten, die durch «notions of difficulty and confusion» (Ebd.: S. 147) die Art der Publikumsinvolvierung reflexiv werden lassen. Dies wird erreicht durch ein embarrassment von productive participation:
«Sharing origins with the word of embargo, an embarrass is ‚an obstacle‘, and ‚embarrasser‘ is ‚to block‘. […] So to embarrass might be to do something to someone by speech or action, to act or speak in such a way as to introduce obstacles or complications»
(Ebd.: S. 209)
Auch in der alltagssprachlichen Verwendung des Wortes embarrassment klingt bereits das Potential an, so Alston, Unbemerktes bemerkbar zu machen:
«On the one hand, to be affected by embarrassment might emerge from breaking with social convention, therefore functioning as a mechanism that sustains the operation of that convention given the Pavlovian corrective discomfort that may ensue while embarrassed; on the other hand, embarrassment might alter the way in which that convention is understood to be just that – a convention. In other words, embarrassment might enable an unearthing of something immaterial that is otherwise not perceivable, or an unmasking of something that is perceivable, or knowable, but is then open to be perceived or known differently»
(Ebd.: S. 209)
Er plädiert jedoch für eine weitere Fassung des Begriffs: «What is more, an embarrass needs not necessarily refer to embarrassment, but any disruption of, or obstacle to, what can be sensed and made sense of» (Ebd.). Seine Beispiele betonen vor allem das Potential des Affekts der Frustration angesichts kosmetischer Entscheidungs- und Partizipationsmöglichkeiten, «[to encourage] audiences to question why they might want to participate and seek out intimacy, exhilaration, thrill and the like» (Ebd.: S. 21). Ebenso ist es jedoch denkbar, gerade durch die Heftigkeit hergestellter Affekte, also durch die Intensivierung von Vereinnahmungsdynamiken, die der Publikumsinvolvierung zugrundeliegenden Machtverhältnisse zu thematisieren (vgl. Schwabe 2018). Das liegt an eben jener Tendenz, die Alston als narzisstisch beschreibt: Der Tatsache, dass man in künstlerischen Settings potenziell gleichzeitig «Subjekt, Objekt und Zeuge» (Schütz/Mühlhoff 2017: S. 23) eines relationalen Affizierungsgeschehens wird, in dem die eigene affektive Eingebundenheit in einem performativen, verkörperten Ausagieren emotionaler Sinngehalte mit Aufführungscharakter, vor den Performer*innen und vor anderen Besucher*innen, münden kann (vgl. ebd.: S. 8). Man beobachtet, wie man reagiert und sich verhält und wie andere reagieren und sich verhalten. Diese doubleness der eigenen Affekte und Reaktionen als «both ‚real‘ and ‚art object`‘» (Alston 2016: S. 58), also in der Möglichkeit der gleichzeitigen ganz realen Vereinnahmung durch den Affekt und der Betrachtung dieser affektiven Reaktion als konstitutiver Bestandteil eines künstlerischen Werks, liegt politisches Potenzial.
Die Strategien, dies zu nutzen – embarrassments und notions of difficulty & confusion zu erzeugen, die Paradigmen der Teilnahme reflexiv werden zu lassen – werden je nach Format und Kontext unterschiedlich aussehen. Von Bedeutung ist, die Kontexte ernst zu nehmen, in denen Publikumspartizipation derzeit stattfindet und Strategien zu entwickeln, die sich dazu verhalten. Dies bedeutet nicht nur eine Einschränkung künstlerischer Möglichkeiten im Umgang mit Partizipation, sondern kann auch und gerade eine Bereicherung darstellen.
- Strategic Experiential Modules: Sense, feel, think, act, relate marketing ↩︎
- Dies steht der Betonung von Interaktivität und Begegnung nicht entgegen: so ist es auch in konsumistischen Settings oft die Erfahrung von Intimität und Verbindung, die beispielsweise in Form eines Versprechens von persönlichem Service saliente Verkaufsstrategie darstellt. ↩︎
Begriffe
Productive Participation
Productive participation ist ein von Adam Alston vorgeschlagenes Konzept, um derzeit saliente Formen von Publikumseinbindung in partizipativen künstlerischen Formaten zu beschreiben. Diese seien gekennzeichnet von einer «objectification of audience experiences according to a logic that chimes with the commodification of experience elsewhere in the experience economy» (Alston 2016: S. 16). Der Tenor: Die vorgebliche nicht-Reproduzierbarkeit von Performances ist nicht mehr dazu in der Lage, der Konsumkultur etwas entgegenzusetzen, weil heutzutage erinnerungswürdige Erfahrungen und ephemere Gefühle die ultimative Ware geworden sind (vgl. ebd.: S. 157). Konsumation und Produktion fällt bei productive participation in eins, das Publikum wird zu Ko-Produzent*innen (oder prosumers) der eigenen Erfahrung, welche primärer, ästhetisch bedeutsamer Bestandteil der Arbeiten ist. Alston sieht hierin eine Romantisierung von Produktivität «in a scheme of production that draws value from affected subjects: a scheme that resources an audience’s participation in immaterial production, including their feeling bodies, intellectual and imaginative abilities, as well as the more noticeable productive exertion of energy in physical endeavour» (Ebd.: S. 222).
Aspekte von productive participation differenziert Alston aus als narcissistic participation und entrepreneurial participation: Ersterer Begriff beschreibt dabei die Tendenz zeitgenössischer partizipativer Formate, die Anwesenheit des Publikums in und die Reaktionen dieses auf eine gestaltete Umgebung gegenüber den traditionellen Objekten ästhetischer Betrachtung (den Performer*innen, dem Bühnenbild, den gesprochenen Worten) in den Vordergrund zu rücken. «It is not so much form, or dramaturgy, or concept, which are the ‚take home‘ aesthetic features […], rather, the experience is the artwork» (Ebd.: S. 48). Mit entrepreneurial participation hingegenbeschreibt er die Tendenz in partizipativen Theaterformaten, Besucher*innen zu bevorteilen und mit bemerkenswert(er)en Erfahrungen zu belohnen, die bereit sind, Risiken einzugehen, ungewohnte Situationen aktiv zu navigieren und Verantwortung für die individuelle Erfahrung zu übernehmen, die sie innerhalb einer künstlerischen Anordnung machen. Entlang der Schlagworte «entrepreneurialism», «opportunism», «personal responsibility» & «risk-taking» zieht er Verbindungen zwischen dieser Form der Publikumseinbindung und neoliberalem Wertekanon (vgl. Alston 2016: S. 133).
Die Paradigmen, unter denen Partizipation in einer spezifischen Anordnung stattfindet, müssen dabei nicht unangefochten bleiben, sondern können durch verschiedene Strategien reflexiv gemacht werden und die Teilnehmenden mit der Frage konfrontieren, «why they might want to participate and seek out intimacy, exhileration, thrill and the like» (Ebd: S. 21).
Quelle
Alston, Adam (2016): Beyond Immersive Theatre. Aesthetics, Politics and Productive Participation. Palgrave Macmillan, Basingstoke