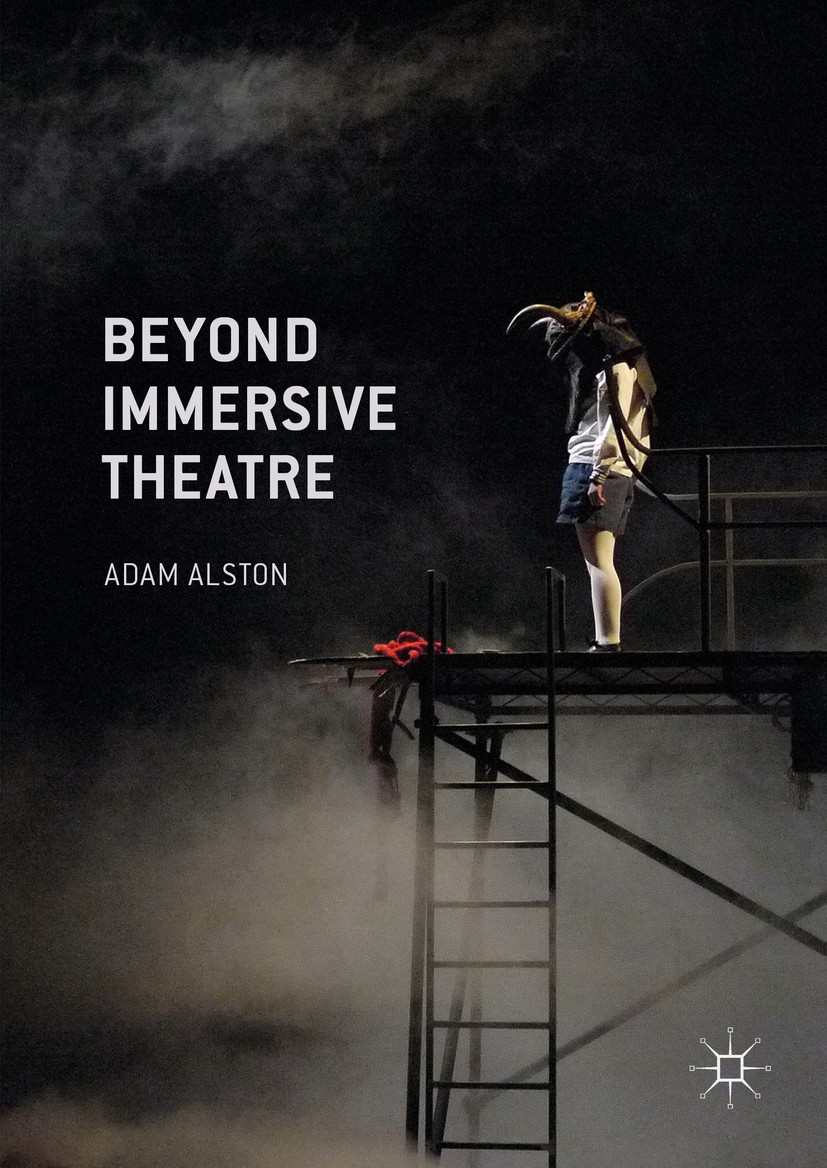(Kolesch 2016)
«Für die Erfahrung der tiefen Versunkenheit, der intensiven Immersion ist insbesondere das Moment der Distanz, des Bruchs konstitutiv. Mit anderen Worten: vor allem die Spannung zwischen dem Ein- und Auftauchen in eine Situation oder eine (virtuelle, künstliche) Welt prägt die Immersionserfahrung. Gleichwohl gehört zum Mythos der Diskurse des Immersiven, einseitig Erfahrungen des Eingetauchtseins, des vollkommenen Gebanntseins in einer anderen Welt zu betonen und das für das Erleben dieser Erfahrungen wesentliche Moment der Distanz und des Rahmenbewusstseins häufig zu unterschlagen. […] Insbesondere in künstlerischen Zusammenhängen wird deutlich, dass […] die Bereitschaft, […] sich distanzlos der Sogwirkung einer Illusion empathisch hinzugeben zur Erklärung immersiver Situationen und Erfahrungen nicht hinreicht: vielmehr geht es um eine subtile Choreografie von Eintauchen und Auftauchen, also ein Zusammenspiel von Illusionierung und Desillusionierung.»
Dieses Zitat von Doris Kolesch trifft in den Kern der Debatten, die sich um das Phänomen Immersion und seine verschiedenen Spielarten entspinnen. Der Begriff beschreibt eine bestimmte subjektive Erlebnisqualität (vgl.: Wendschoff 2015: S. 3) und stellt in der derzeitigen Theaterlandschaft und in konsumistisch-kapitalistischen Kontexten ein populäres Wirkungsversprechen dar (vgl.: Schütz/Mühlhoff 2017). Weder das Phänomen noch die spezifische Fragestellung der Debatten sind allerdings neu: Schon häufig und in unterschiedlichen Zusammenhängen1 ging es dabei um die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Immersion und kritischer Reflexion (vgl. Wendschoff 2015: S. 12, 68) sowie um Fragen der Selbst- oder Fremdbestimmtheit des immersivierten Subjekts, was sich in Schlagworten wie Entmündigung (vgl.: Schütz 2016: S. 24),2 Verführung (vgl. Kolesch 2016) und anti-aufklärerische Manipulation (vgl. ebd.) niederschlägt.
Die Problematik, so Miriam Wendschoff, sei schon im Wortsinn angelegt: «Denn wenn Immersion bedeutet, in Etwas drinnen zu sein und es von innen zu erleben, impliziert eine reflektierende Haltung, synonym verwendet mit dem Begriff ‚kritische Distanz‘, eine Draufsicht von außenstehender Position» (Wenschoff 2015: S. 12).
Eine Schlüsselrolle für diese dichotome Gegenüberstellung kommt der im Rahmen von Immersionserfahrungen hervorgerufenen affektiven und emotionalen Involvierung zu, welche die Fragestellung in einem langjährigen Diskurs über das Verhältnis und die (Un)Vereinbarkeit von Rationalität und Affektivität situiert.3 Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass in einem Atemzug die Minderung kritischer Distanzierung und emotionale Involvierung (Grau 2016: S. 16) als Kennzeichen von Immersion in Verbindung gebracht werden, welche von Oliver Grau als eine (in den meisten Fällen) «mentale Absorbierung» (Ebd.) charakterisiert wird. Noch deutlicher wird die dichotome Handhabung von Affekt und Verstand in einem Zitat von Erika Fischer-Lichte über ästhetische Erfahrungen:
«Der Zuschauer [vollzieht] seine Wahrnehmung […] immer […] unter Rekurs auf sein Bedeutungssystem. Je stärker allerdings die von seinem Bedeutungssystem […] mitbedingten Gefühle […], um so mehr [lassen] sie das Bedeutungssystem als Quelle und Ursprung in den Hintergrund treten, ja teilweise gänzlich in Vergessenheit geraten und [werden] als eine intensive körperliche Erfahrung durchlebt.»
(Fischer-Lichte 2003: S. 152)
Die These dahinter: Eine intensive (sinnliche, körperliche, emotionale) Affizierung verdrängt die Fähigkeit, über die kulturelle und biografische Verfasstheit der eigenen Reaktionen zu reflektieren. Der Ursprung des Affekts bliebe demnach unhinterfragt. Ein solcher Vereinnahmungsprozess würde in der Tat Möglichkeiten zur Manipulation eröffnen, denn auch Strategien zur «Förderung emotionaler Wirkung» (Grau 2016: S. 3) oder zur «kalkulativen Produktion[…] von Emotionen» (Ebd.: S. 8) würden potentiell unerkannt bleiben und hintergründig gegenüber der hervorgerufenen Emotion.
Nicht immer jedoch wird dieses Verhältnis so eindeutig gedacht. So gibt es ebenso positive Konzepte körperlich-sinnlich-emotionaler Erfahrungen,4 die These, dass Reflexionsmomente bei Erfahrungen von Immersion schlicht zeitlich verschoben und «an das dafür umso intensivere ästhetische Erlebnis angestellt» (Wendschoff 2015: S. 69) sind – und zu guter Letzt beruht der Manipulationsvorwurf nach der Auffassung einiger Autor*innen auf einer mythisch überhöhten Vorstellung von vollständiger Immersion und Illusion. Diese müsse als «hypothetisches Ideal verstanden werden, das nie ganz erreicht werden kann, außer als pathologischer Zustand» (Ebd.: S. 11).5
Oliver Grau bringt die vielschichtigen Verstrickungen prägnant auf den Punkt: «[S]elbstverständlich besteht zwischen kritischer Distanz und Immersion nicht ein schlichter Zusammenhang im Sinne eines ‚Entweder-oder‘. Die Verbindungen sind vielmehr vielschichtig, verwoben, dialektisch, teilweise widersprüchlich» (Grau 2016: S. 16).
Theresa Schütz und Rainer Mühlhoff entwerfen vor diesem Hintergrund eine affekttheoretische Konzeption von Immersion als eine im Affektiven wirksame Modalität von Gouvernementalität, die nicht vorrangig als Rezeptionsphänomen in theatralen, künstlerischen und medientechnologischen Kontexten von Relevanz ist, sondern als ein situativer Effekt des Sich-Einlassens auf eine gestaltete und sozial-relationale Wirkungsumgebung (vgl. Mühlhoff/Schütz 2017: S. 3) eine eindeutig sozialtheoretische Dimension besitzt. Als Beispiele für einen solchen Immersionseffekt6 nennen die Autor*innen neben künstlerische Settings auch Nachtclubs (als Beispiel für Immersion in Konsum- und Erlebniswelten), Ausbildungsformate (wie historische Reenactments und Schlachtsimulationen) und modernes Human Resource Management (insbesondere das Teamwork-Paradigma) (Vgl.: Mühlhoff/Schütz 2017: S. 5-16). Die Fokussierung auf soziale Beeinflussungsdynamiken machen dieses Konzept für partizipative Projekte sowohl künstlerischer wie pädagogischer Natur interessant.
Immersion beschreibt in dieser Auffassung eine spezifische Art emotionaler und affektiver Involvierung: Einen Prozess, in dem das Individuum durch reziproke Affizierungsdynamiken in eine lokale Umgebung eingebunden wird (vgl. ebd.: S. 1) und der – in Abgrenzung zu nicht-immersiven Affizierungsgeschehen – eine bestimmte Qualität der Vereinnahmung oder Verschmelzung aufweist (vgl. ebd.: S. 17). Dies bedeutet, dass in solchen Konstellationen die relationale Dynamik «das Individuum ganz in den Bann ihrer konkreten lokalen Gesetzmäßigkeiten nimmt [und] in die innere Funktionslogik eines (affektiven, sozialen, diskursiven, symbolischen, institutionellen) Kräftegefüges einhegt» (vgl. ebd.). Das dadurch erwirkte framing der Denk- und Handlungsmöglichkeiten bedeutet eine Fokussierung oder Verengung gegenüber dem dem Individuum alltäglich und gesamtbiografisch verfügbaren Spektrum des Denkens, Fühlens und Handelns (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass ein bestimmter Teil der affektiven Disposition «subtil intensiviert» (ebd.: S. 24) ist und «durch situative Rahmung gegenüber anderen möglichen Teilen seines [affektiven] Vermögens prädisponiert» (Ebd.) wird, wodurch das Individuum von anderen Teilen seiner affektiven Disposition mehr oder weniger abgeschnitten ist und nicht mehr in vollem Maße über seine (persönlichen, politischen, symbolischen) Bezüge zur Außenwelt verfügt (vgl. ebd.: S. 21). Dies geschieht mithilfe einer «Modifikation, Intensivierung oder Aussetzung alltäglicher Interaktionsmuster, affektiver Dynamiken und sozialer Konventionen und Umgebungsparameter[…]» (Ebd.: S. 10).
Dadurch, dass das Verhalten und Empfinden des Subjekts in solchen Settings aus eigener Aktivität und der eigenen affektiven Disposition entspringt, die Wirkungsumgebung den Handlungsspielraum allerdings (mal mehr, mal weniger subtil) vorstrukturiert und das Zutagetreten bestimmter Aspekte dieser (kulturell und autobiografisch bedingten) Disposition fördert, bezeichnen Theresa Schütz und Rainer Mühlhoff Immersion als «vergleichsweise gewaltlose[n]» (ebd.: S. 26) Modus der Verhaltenskontrolle und Einwirkung auf Subjekte, die anderen Formen der Einwirkung wie der Repression, dem Zwang, der Weisung, der Abrichtung oder Unterwerfung entgegengesetzt ist und die insbesondere in vermeintlich a-hierarchischen und sozial-relationalen Kontexten von Bedeutung ist (vgl. ebd. S. 24). «So sind immersiv verlaufende Situationen gerade durch die subjektive Erfahrung eines eigenen Handlungsspielraums gekennzeichnet, der aber zugleich subtil vorstrukturiert und geframed [ist]» (Ebd.: S. 25). Die Macht- und Subjektivierungswirkung liegt hier weder in einer diachronen Prägung durch Disziplinierung, noch in einer Bindung des Subjekts an Normen, Konventionen und Ordnungen, sondern verläuft situativ und ephemer und beruht auf der Störung oder Verstörung sozialer Normen und Normalverhaltensweisen durch Intensivierung und Verwertung bestimmter Formen der Affizierbarkeit (vgl. ebd.: S. 25).
Kennzeichnend für sie ist ein Prozess der Gewöhnung: Die reziproke Affizierungsdynamik stabilisiert sich in einem bestimmten Rückkopplungsmuster, für das einerseits alle Beteiligten eine bestimmte Anfälligkeit als Teil ihrer affektiven Disposition hineingetragen haben, das aber zugleich durch die Wirkungsumgebung selektiv verstärkt ist. Dies führt zur Einübung einer bestimmten Subjektivität, mit der eine potentielle anfängliche Verunsicherung beim Eintritt in die immersive Wirkungsumgebung nachlässt (vgl. ebd.: S. 22). Die «immersive Macht [der] Erfahrungs- und Affizierungsmaschine […] wird wirksam» (Ebd.), wie Theresa Schütz und Rainer Mühlhoff schreiben.
Diese Verbindung von Immersion, Beeinflussung und Macht im Auge zu behalten eröffnet interessante Möglichkeiten und Herausforderungen für die Konzeption partizipativer Formate, seien sie künstlerischer oder pädagogischer Natur, die die Einbettung des Individuums in einen sozialen Kontext mit sich bringen. In dem gemeinsamen Betrachten der produzierten Affekte, einmal von ihnen erfasst und vereinnahmt, anderseits diese auch als Bestandteil eines künstlerischen Werks oder Sujet pädagogischer Auseinandersetzung behandelnd, läge die Chance zu einem besseren Verständnis auch alltäglicher Vereinnahmungsdynamiken – ohne einer verkürzten Ineinssetzung von Partizipationsmöglichkeiten mit Freiheit und Ermächtigung zu folgen.
- Für eine Darstellung dieser Zusammenhänge vgl. beispielsweise: Kolesch 2016. ↩︎
- Theresa Schütz bezieht sich hier auf Esther Slevogt, die den Vorwurf der Entmündigung damit begründet, dass all die sich an das «Zauberwort» Immersion knüpfenden Beispiele (Computerspiele, Performanceinstallationen des Kollektivs SIGNA, Shoppingmalls und IKEA) die «Besucherinnen und Besucher auf eine Weise involvierten, die Körper und Sinne derart in Anspruch nähmen, dass die Distanz zum Inszenierten und theatral Verfassten verloren ginge.» ↩︎
- Adam Alston liefert in seinem Buch Beyond Immersive Theatre. Aesthetics, Politics and Productive Participation einen kurzen historischen Überblick über zwei philosophische Strömungen, die für diesen Diskurs prägend waren. Einen Strang verfolgt er von Descartes über Kant zum «Rational Actor Paradigm», den anderen von Spinoza über Deleuze hin zu modernen Vorstellungen einer «embodied mind». (Vgl. Alston 2016: S. 40-42) ↩︎
- Doris Kolesch zitiert einen Abschnitt aus Laura Biegers Ästhetik der Immersion, welcher eine solche Wertung nahelegt: «Die Ästhetik der Immersion ist eine Ästhetik des Eintauchens, ein kalkuliertes Spiel mit der Auflösung von Distanz. Sie ist eine Ästhetik des empathischen körperlichen Erlebens und keine Ästhetik der kühlen Interpretation» (Kolesch 2016). Auch Wendschoff schreibt: «[E]ine immersive Performance-Installation [ließe sich auch] als Erfahrungsraum verstehen, der gerade durch seine affektive Intensität bei den Rezipierenden Reaktionen auslöst» (Wendschoff 2015: S. 68). ↩︎
- Eine ähnliche These vertritt auch Doris Kolesch in dem eingangs zitierten Ausschnitt. ↩︎
- In diesem Kontext scheint der Begriff «Immersionseffekt» sinnvoller als «Immersionserfahrung», da Theresa Schütz und Rainer Mühlhoffs Definition offen lässt, ob es sich um ein unbewusst ablaufendes Hineinmodulieren des Individuums in eine Wirkungsumgebung oder um ein bewusstes Sich-Einlassen auf eine fiktive oder künstliche oder als eindeutig andersartig erfahrene Umgebung handelt. Auch ein mögliches Rahmenbewusstsein rückt als Kriterium in den Hintergrund, wenn der Immersionseffekt nicht mehr an eine begrenzte Zeitspanne mit einem Moment des Ein- und Auftauchens gebunden ist, sondern episodisch und beinahe alltäglich sein kann (Vgl.: Mühlhoff/Schütz 2017: S. 15). ↩︎
Begriffe
Immersion
Das sich von dem lateinischen Wort immergere ableitende Wort (vgl.: Mühlhoff/Schütz 2017: S. 1) wird im übertragenen Sinne für Momente des Sich-Versenkens oder Sich-Vertiefens verwendet (vgl.: Kolesch 2016) – als Bezeichnung für einen «situativen Einbettungsmodus eines Subjekts in eine spezifische Umgebung“ (Mühlhoff/Schütz 2017. S. 1). Dabei kann es sowohl einen «(aktivischen) Prozess des ‹Eintauchens› [als auch] den (passivischen) Zustand des ‹Eingetauchtseins’» (Ebd.) beschreiben. Beispiele für seine Verwendung findet man u.a. in Theater-, Kunst- und Medienwissenschaft, konsumistischen Settings und Werbung, Medientechnologie, Sozialwissenschaft, Mikroskopie, Pädagogik und Religion (vgl. ebd.: S. 1-7).
In den Kunst- und Medienwissenschaften wird Immersion als Rezeptionsphänomen gehandhabt, das mit einer gewissen Qualität der Vereinnahmung einhergeht. Teilweise wird er auch als Genrebezeichnung verwendet, z.B. in der Formulierung Immersive Theatre. Aufgrund der Unschärfe des Begriffs, seiner metaphorisch-bildlichen Bedeutung (vgl. ebd.: S. 1) und der medienübergreifenden Signifikanz bei gleichzeitiger medienspezifischer Schwerpunktlegung (vgl. Wendschoff 2015: S. 4) bleibt die Bezeichnung jedoch mehrdeutig.
Quelle
Kolesch, Doris (2016): Theater und Immersion. In: Berliner Festspiele Blog. http://blog.berlinerfestspiele.de/theater-und-immersion (verifiziert am 13.08.2018)
Mühlhoff, Rainer; Schütz, Theresa (2017): Verunsichern, Vereinnahmen, Verschmelzen. Eine affekttheoretische Perspektive auf Immersion. In: Working Paper SFB 1171 Affective Societies. Internet: http://www.sfb-affectivesocieties.de/publikationen/workingpaperseries/wps_10/wp10_muehlhoff_schuetz.pdf (13.08.2018)
Wendschoff, Miriam (2015): Zur Konzeption eines immersiven Theaters. Eine Analyse von Inszenierungsstrategien zur Erzeugung von Immersion in zeitgenössischen Performance-Installationen. Universität Hildesheim
Affektive Disposition
«When someone is affected, they are influenced by someone or something. They are made to move, think, feel or act in a way that may not be fully at the subject’s command. There is consequently a politics of biology of affect production – or ‚biopolitics‘. […] The biopolitics of affect production […] involves negotiation between being influenced and evading influence, or influencing other people and things, or having that influence evaded. […] To be affected is not necessarily to be subjugated; it might just as well be an active process of negotiating power.»
Alston 2016: S. 43
Affektive Disposition bezeichnet eine spezifische «Sensitivität für Affizierungen» (vgl. Mühlhoff/Schütz 2017: S. 18) jedes Individuums, die «biografisch und ontogenetisch hervorgebracht [ist], zugleich jedoch situativ stets moduliert» (Ebd.). Diese speist sich u.a. aus Körpergedächtnis, medial zirkulierenden und im kulturellen Gedächtnis abgelegten Bildern und Vorstellungen, Erinnerungen, affektiven Spuren vergangener Erfahrungen, in anderen sozialen Relationen und Konstellationen eingeübte affektive Resonanzmuster, Dispositionen, Verletzlichkeiten und Traumata (vgl. ebd.: S. 7, 18). Ein Beispiel, das Schütz und Mühlhoff nennen, ist die Möglichkeit, dass in Teamwork-Situationen Prädispositionen zu Schuldgefühlen, Anerkennungsbedürfnissen oder Gruppenveranwortlichkeitsgefühlen angesprochen werden.
Die affektive Disposition wirkt nicht deterministisch: «Ein Individuum kann […] in ein ganzes Spektrum verschiedener Muster und Dynamiken des Affizierens und des Affiziertwerdens treten» (Ebd.: S. 19). Dabei sind seine Reaktionen weder bloss Produkt seiner Vergangenheit, noch ausschließlich der gegenwärtigen Situation: Alle an einer Situation beteiligten Dinge und Individuen inklusive ihrer jeweiligen affektiven Dispositionen bestimmen die zutage tretenden Dynamiken mit (vgl. ebd.). Das Individuum kann so in «unterschiedliche Interaktionsformen und Resonanzmuster involviert werden, in die es partiell hineinmoduliert wird, die es partiell aber auch selbst mitproduziert. Diese […] knüpfen jeweils an unterschiedliche Aspekte seiner/ihrer affektiven Disposition mehr und an andere weniger an, und bringen diese Disposition somit je nach situativer Einbindung differenziell zur Geltung» (Ebd.: S. 19).
Der Begriff ist ein Schlüsselbegriff in der sozialtheoretischen Konzeption von Immersion als im Affektiven wirksame Modalität von Macht, wie sie Therasa Schütz und Rainer Mühlhoff vorschlagen, und eignet sich damit zur Betrachtung der machtpolitischen Dimensionen partizipativer Formate in künstlerischen und anderen Kontexten.
Quelle
Alston, Adam (2016): Beyond Immersive Theatre. Aesthetics, Politics and Productive Participation. Palgrave Macmillan, Basingstoke
Mühlhoff, Rainer; Schütz, Theresa (2017): Verunsichern, Vereinnahmen, Verschmelzen. Eine affekttheoretische Perspektive auf Immersion. In: Working Paper SFB 1171 Affective Societies. Internet: http://www.sfb-affectivesocieties.de/publikationen/workingpaperseries/wps_10/wp10_muehlhoff_schuetz.pdf (13.08.2018)